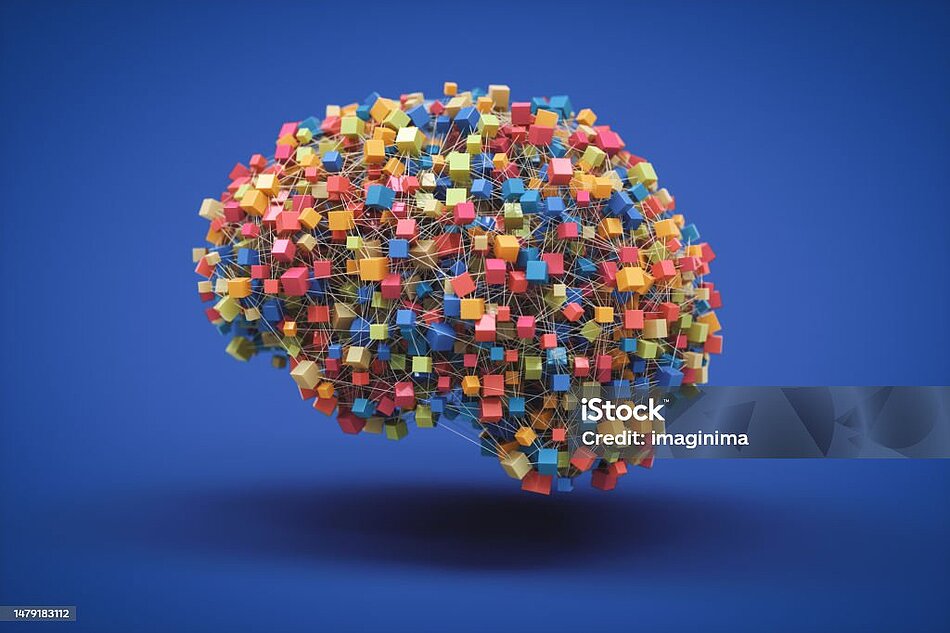Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die medizinische Diagnostik und Therapie zu optimieren, Fachkräfte zu entlasten und die Gesundheitskompetenz der Patienten zu stärken. Doch die Technologie birgt auch Risiken: So ist nicht immer nachvollziehbar, welche Daten einer Anwendung zugrunde liegen und möglicherweise Ergebnisse verzerren. Zudem neigen Modelle wie ChatGPT zum Halluzinieren, warnen Experten.
von Heike Korzilius
„Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, Dinge zu tun, die bei Menschen Intelligenz voraussetzt“, zitierte Professor Dr. rer. nat. Andreas Dengel frei Marvin Minsky, einen der geistigen Väter der KI. Die Technologie habe das Potenzial, die Welt zu verändern, weil sie menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität imitieren könne, sagte der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern bei der Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein am 22. März im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft, die dem Thema „KI in der Medizin“ einen eigenen Tagesordnungspunkt gewidmet hatte. Befeuert werde die Entwicklung durch das Vorhandensein massiver Datenmengen, enorme Rechenleistung und Machine Deep Learning, maschinelles Lernen, das sich auf künstliche neuronale Netze und große Datenmengen fokussiere. Deep Learning werde unter anderem dazu genutzt, Bilder zu erkennen und Texte zu verstehen. Doch neben den großen Chancen von KI wies Dengel gleich zu Beginn seines Vortrags auch auf die Risiken hin: Große generative Sprachmodelle wie ChatGPT arbeiteten rein auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und nicht faktenbasiert. „ChatGPT halluziniert. Das ist ein großer Schwachpunkt“, warnte Dengel.
Künstliche Intelligenz kommt zunehmend in der Gesundheitsversorgung zum Einsatz, insbesondere in der Bildgebung, in der Diagnostik und bei der Dokumentation. Einer Umfrage zufolge nutzt bereits ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland KIAnwendungen in der Patientenversorgung. Fast zwei Drittel schätzen das Potenzial von KI als hoch oder sehr hoch ein. Die Ergebnisse entstammen einer Befragung des Vereins Gesundheitsstadt Berlin von Ende 2024 unter rund 300 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. An der Trendstudie, die finanziell vom Terminbuchungsportal Doctolib unterstützt wurde, wirkten Experten mehrerer Kassenärztlicher Vereinigungen und Landesärztekammern mit. Ein weiteres Ergebnis: 80 Prozent der Befragten wünschten sich mehr Aufklärung und Fortbildung für einen sichereren Umgang mit KI.
Der Kompetenzerwerb für eine informierte Anwendung von KI ist aus Sicht des Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein, Dr. Sven Dreyer, eine der zentralen Herausforderungen. Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit KI-Anwendungen müssten in der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung fest verankert werden – und zwar für alle Ärztinnen und Ärzte. „Wir wollen dafür nicht nur unsere eigenen Gremien in die Pflicht nehmen, sondern appellieren auch an Universitäten und Anbieter von ärztlichen Fortbildungen, entsprechende Curricula und Module zu entwickeln“, sagte Dreyer bei der Kammerversammlung. Nur wer Chancen und Risiken von KI-Anwendungen beurteilen könne, könne die neuen Technologien auch im Sinne der Patientensicherheit in der Versorgung anwenden. Und nur so lasse sich verhindern, dass die zunehmende KI-Unterstützung in Diagnostik und Therapie zu einem Kompetenz- und Kontrollverlust bei Ärztinnen und Ärzten führe, weil sie sich blind auf KI-Modelle verließen. Die Kammerversammlung bekräftigte diese Einschätzung und forderte darüber hinaus die Bundesregierung und die NRW-Landesregierung auf, die Ärzteschaft in die Zulassung, Regulierung und Qualitätssicherung von KI-Anwendungen in der Medizin einzubeziehen (siehe Entschließungen).
„KI ist kein Ersatz für menschliche Intelligenz, und medizinische Entscheidungen können nicht an KI delegiert werden“, betonte Informatiker Dengel. Er sieht die Technologie in bestimmten Medizinfeldern als wichtiges Unterstützungssystem, das man wie die Zweitmeinung eines Kollegen in Diagnostik und Therapie einbeziehen sollte. Selbst wenn in Zukunft Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften den Einsatz von KI vorschrieben, sei es juristisch immer noch so, dass letztlich der Mensch verantwortlich sei, betonte Dengel. „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.“

Ärztliche Fähigkeiten erhalten
Allerdings sieht auch der Informatiker die Gefahr, dass die zunehmende Nutzung von Assistenzsystemen dazu führen kann, dass ärztliche Fähigkeiten verloren gehen. Dengel verglich das mit dem Navigationssystem im Auto. Dessen Routenvorschläge würden von den meisten Fahrern nicht mehr kritisch hinterfragt, weil sie meistens funktionierten. Er appellierte deshalb an die Ärztinnen und Ärzte, stets die Verlässlichkeit der Datenbasis einer KI-Anwendung zu überprüfen. Hier sei auch der Gesetzgeber in der Pflicht, angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen.
Eine hohe methodische Expertise zur Einordnung der Ergebnisse von KI-Anwendungen hatte der Deutsche Ethikrat bereits im März 2023 denjenigen empfohlen, die KI routinemäßig anwenden. Zugleich hatte er strenge Sorgfaltspflichten bei der Datenerhebung und -weitergabe sowie bei der Plausibilitätsprüfung „maschinell gegebener Handlungsempfehlungen“ gefordert. Wie Dengel hob auch der Ethikrat die menschliche Letztverantwortung hervor. Ein vollständiger Ersatz ärztlicher Fachkräfte durch ein KI-System gefährde das Patientenwohl und sei auch nicht durch Personalmangel zu rechtfertigen.
Die Bundesärztekammer (BÄK) hält das Thema „KI in der Medizin“ für so wichtig, dass sie es zu einem Schwerpunkt der aktuellen Wahlperiode 2023–2027 gemacht hat und ihm auch beim diesjährigen Deutschen Ärztetag Ende Mai in Leipzig einen eigenen Tagesordnungspunkt widmet. Als Diskussionsgrundlage für die rund 250 Delegierten haben die Gremien der BÄK eine Stellungnahme und ein Thesenpapier erarbeitet.
Den Status quo von KI in der Medizin und damit verbundene Risiken und Chancen aus medizinisch-wissenschaftlicher Perspektive darzustellen, war das Ziel der Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der BÄK, die dieser Ende Februar vorlegte. Auch er sieht klar das Potenzial von KI, Diagnostik und Therapie zu optimieren und Fachkräfte zu entlasten. Wie der Ethikrat fordert aber auch der Wissenschaftliche Beirat, die Ergebnisse von KI-Anwendungen stets einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen und auch er betont, dass die Verantwortung für Diagnostik, Indikationsstellung und Therapie Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten bleibt.
Das Thesenpapier „Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung“, das die BÄK Ende März vorlegte, fasst die Entwicklungen und Herausforderungen für Ärzte und Patienten durch die Einführung von KI-Systemen in den kommenden drei bis fünf Jahren zusammen. Formuliert hat die BÄK ihre Thesen nach eigenen Angaben auf der Grundlage von Werkstattgesprächen mit Experten aus Politik, Gesundheitsversorgung und Gesundheitswirtschaft. „KI-Systeme werden die auf genetischen und anderen individuellen Gesundheitsdaten basierenden, maßgeschneiderten Therapiepläne weiter präzisieren und noch passgenauere Therapien ermöglichen“, sagte BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt anlässlich der Veröffentlichung des Papiers. „KI kann Ärztinnen und Ärzte zudem bei Routineaufgaben wie der Dokumentation, der Abrechnung und der Terminplanung unterstützen.“ Diese Entwicklung wolle die Ärzteschaft im Sinne der Patientinnen und Patienten aktiv mitgestalten. Dazu müsse auch die Forschung zu medizinischen KI-Anwendungen gestärkt und es müssten Strukturen geschaffen werden, damit evidenzbasierte KI-Anwendungen zügig in der Gesundheitsversorgung zum Einsatz kommen könnten, forderte PD Dr. Peter Bobbert, Co-Vorsitzender des BÄK-Ausschusses „Digitalisierung der Gesundheitsversorgung“.
Denn die Bevölkerung scheint dem Thema grundsätzlich offen gegenüber zu stehen. Nach einer repräsentativen Befragung des Branchenverbandes Bitkom unter 1.140 Personen in Deutschland, die das Thesenpapier zitiert, finden 71 Prozent, Ärztinnen und Ärzte sollten, wann immer möglich, Unterstützung von einer KI erhalten. Fast die Hälfte (47 Prozent) meint, eine KI könne in bestimmten Fällen bessere Diagnosen stellen als eine Ärztin oder ein Arzt. Von allen Seiten würden hohe Erwartungen an den Einsatz von KI in der Versorgung allgemein, an die ärztliche Tätigkeit und an die Weiterentwicklung des Arzt-Patienten-Verhältnisses geknüpft, folgert daraus die BÄK. Von Ärztinnen und Ärzten werde mithin nicht nur Offenheit gegenüber KI-Technologien erwartet, sondern auch deren verantwortungsvoller Einsatz zum Wohle der Patientinnen und Patienten.
Neben der Mustererkennung in bildgebenden Verfahren hält die BÄK zunächst insbesondere solche KI-Lösungen für erfolgreich, die auf Effizienzsteigerung abzielen und verwaltungstechnische und organisatorische Prozesse sowie Routinetätigkeiten und gewisse standardisierte Kommunikationstätigkeiten übernehmen oder unterstützen. Zudem rechnet sie damit, dass Patientinnen und Patienten KI verstärkt nutzen und ihre Ärzte mit den Ergebnissen konfrontieren werden. Nach der Bitkom-Umfrage können sich 51 Prozent der Befragten vorstellen, KI künftig um eine Zweitmeinung zu bitten. Ärztinnen und Ärzte, so die BÄK, seien in Zukunft daher auch in der Rolle als „digitale Lotsen“ zur Nutzung von KI-Anwendungen gefragt.
„KI hat das Potenzial, die Medizin und die ärztliche Profession vollumfänglich zu verändern“, betont die BÄK. Es sei ärztliche Kernaufgabe, diese Veränderung im Sinne der Patienten zu begleiten und zu gestalten. Dafür brauche es einen gewissen Technikoptimismus und ein grundsätzliches Vertrauen in die Potenziale von KI.
Ein Bericht über die gesundheitspolitischen Schwerpunkte der Kammerversammlung am 22. März sowie die dort verabschiedeten Entschließungen finden sich unter
www.aekno.de/kammerversammlung/maerz-2025. Die Entschließungen sind in der Mai-Ausgabe des Rheinischen Ärzteblatts ab Seite 15 veröffentlicht.
Die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer „Künstliche Intelligenz in der Medizin“ ist abrufbar unter https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/wissenschaftlicher-beirat/Veroeffentlichungen/KI_in_der_Medizin_SN_neu.pdf.
Das Thesenpapier „Künstliche Intelligenz in der Gesundheitsversorgung“ ist abrufbar unter
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Digitalisierung/Thesenpapier_KI_in_der_Gesundheitsversorgung_03.2025.pdf.