„Work-Life-Sleep-Balance“ lautet dieser Tage ein Slogan auf Großleinwänden in Städten wie Köln. Der Werbespruch eines Einrichtungshauses dürfte auch den Nerv vieler junger Ärzte treffen, die laut einer Umfrage zum Beispiel über zu viele Dienste und belastende Wechselschichten klagen. Auch mangelnde Flexibilität verleidet manchem Kollegen die Freude am Beruf.
von Bülent Erdogan
„Dialogforum der Bundesärztekammer und der Landesärztekammern“ lautet der Titel einer Veranstaltung, die seit 2016 am Vorabend des jeweiligen Deutschen Ärztetags stattfindet. Junge Ärztinnen und Ärzte sind auf dem Dialogforum aufgerufen, ihre Ansichten und Standpunkte zu verschiedenen Aspekten des Arztberufs kundzutun (siehe auch RÄ 7/2019, S. 19). Im Fokus stand dieses Mal in Münster die „Versorgung von morgen“ und dabei insbesondere Wünsche und Erwartungen der jungen Mediziner an eine erfüllende ärztliche Tätigkeit. Zu Wort meldete sich auf dem Podium damals auch ein junger Klinikarzt: Im stationären Setting, so der frischgebackene Vater, sei es mit der Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf nicht so gut bestellt. „Ich habe zwar theoretisch Dienstschluss um 17 Uhr, aber faktisch ist das ein Glücksspiel.“ Der Dienstschluss als Glücksspiel? Allen Reden und Appellen und Einsichten zum Trotz gibt es immer noch Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (und einem gesunden Schlaf)? Und das in einem Land, in dem landauf, landab von einem immer größer werdenden Mangel an Ärzten, Pflegenden, Lehrern und vielen anderen Berufen die Rede ist?
Zieht man die „Assistenzarztumfrage 2018/19“ des Hartmannbundes (HB) zu Rate, dann ist an dieser Aussage, zumindest unter jungen Ärztinnen und Ärzten, wohl noch etwas dran – auch wenn man annehmen kann, dass bei einer solchen Erhebung tendenziell eher Ärzte mitmachen, die unzufrieden mit Aspekten ihres Arbeitslebens sind. Mit die größten Belastungen empfindet der ärztliche Nachwuchs bezüglich der Zahl zu leistender Dienste (Rufbereitschaft, Bereitschaftsdienste) oder der Schicht-Organisation. Mit 52,5 Prozent schafft es dieser Punkt jedenfalls an die Spitze der Tabelle (siehe Balkendiagramm auf Seite 13). 44,7 Prozent der Umfrageteilnehmer klagen darüber, dass eine flexible Arbeitszeitgestaltung in ihrem Alltag Fehlanzeige ist. Drei von zehn Ärzten kritisieren zu kurze oder unflexible Betreuungszeiten an Kitas oder dass Kitaplätze gleich ganz fehlen, 22 Prozent fehlende kurzfristige Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder, wenn auch die Arbeitsanforderung kurzfristig erfolgt. 24,9 Prozent sehen sich von Kollegen oder dem Chef unter Druck gesetzt, das Pendel zugunsten der Arbeit ausschlagen zu lassen und Familie oder Freizeit hintanzustellen. 13,8 Prozent der Befragten sehen in befristeten Arbeitsverträgen ein Hindernis für eine Work-Life-Balance. 29,4 Prozent der Befragten kommen auf sieben bis zwölf Überstunden pro Woche, nur 3,5 Prozent geben an, sie kommen mit der vereinbarten Arbeitszeit hin. Einblicke wie diese passen zum Befund, dass in Deutschland jeder dritte Angestellte im Berufsleben ein Jahr lang unentgeltlich tätig ist, wie die Firma Compensation Partner aus Hamburg kürzlich mittels einer Befragung von 215.000 Beschäftigten herausgefunden haben will.
Überstunden: Per definitionem nicht vorhanden. Durchgestrichen. Oder OP-Verbot.
27 eng beschriebene Seiten lang sind die Freitext-Antworten von Ärztinnen und Ärzten auf die Frage: „Wie kompliziert ist es, Überstunden/Mehrarbeit zu dokumentieren?“
Eine Auswahl:
- „Bisher wurden Überstunden unter den Tisch gekehrt. Mittlerweile unterzeichnet unser Chef die getätigten Überstunden – Geld haben wir dafür jedoch bisher keines gesehen.“
- „Überstunden werden handschriftlich auf einen Planer aufgeschrieben und ggf. vom Chef durchgestrichen. Von 24-Stun-den-Diensten werden nur acht bezahlt.“
- „Per Definition nicht vorhanden.“
- „Gerade jungen Kollegen wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn sie Überstunden dokumentieren. Sie seien ja noch nicht dienstfit, da gehöre es sich nicht, Überstunden aufzuschreiben. Auf der anderen Seite wird ihnen aber ebenso viel abverlangt wie den älteren Kollegen. Die Dokumentation ist jedoch relativ einfach. Es hängt eine Liste im Sekretariat.“
- „Wer Überstunden angibt, kommt nicht in den OP.“
- „Überstunden sind offiziell nicht erwünscht und per Dienstanweisung untersagt. In der Regelarbeitszeit ist jedoch die Patientenversorgung nicht zu gewährleisten.“
- „Überstunden gibt es nicht, wenn man nur wichtige Dinge tut…hahaha.“
- „Jede Überstunde muss per Mail begründet und vom Dienstplaner händisch abgesegnet und eingegeben werden.“
- „Handschriftlich statt digital. Sonst Note 1“
- „Es kam der Vorschlag auszustempeln und weiterzuarbeiten.“
- „Kompliziert ist es nicht. Das läuft über eine Chipkarte. Es werden aber nur die Überstunden abends bis 19 Uhr anerkannt. Morgens komme ich eine Stunde früher, abends gehe ich i. d. R. gegen 21 Uhr, sodass ich auf circa drei Überstunden am Tag komme. Sonst ist die Arbeit nicht zu schaffen oder die Patientenversorgung leidet.“
- „Überstunden nach 24-Stunden-Bereitschaftsdienst dürfen nicht dokumentiert werden.“
- „Befristete Verträge zwingen die Assistenten Mehrarbeit nicht zu dokumentieren. Entsprechende Ansagen von der Führungsebene sind mehrfach erfolgt. Es ist eine Ehre an einer Uni länger arbeiten zu dürfen.“
Quelle: Umfrage „Assistenzärzte im Hartmannbund 2018/19“
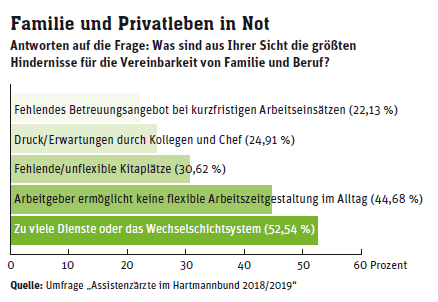
Teilnehmer der HB-Umfrage kommen auf Wochenarbeitszeiten von 50 bis 55 Stunden, 19,1 Prozent geben einen Korridor von 55 bis 60 und 14,1 Prozent von mehr als 60 Stunden an. 10,6 Prozent der meist jungen Ärztinnen und Ärzte berichten von einer Arbeitszeit von 40 bis 45 Stunden, zehn Prozent bleiben unterhalb von 40 Stunden. Ein Medianwert ist nicht angegeben, und doch liest sich die Statistik, als sei „New Work“ (Frithjof Bergmann) für viele Klinikverantwortliche noch immer ein Begriff aus einem Paralleluniversum: Fast 60 Prozent der Befragten arbeiteten 50 Stunden und mehr in der Woche. Und noch viel zu häufig werden Überstunden nicht oder nicht komplett erfasst, vergütet oder in Freizeit ausgeglichen, wie viele, teils frustrane Schilderungen (siehe Kasten) verdeutlichen.
Laut einer Erhebung der Klinikärztegewerkschaft Marburger Bund (MB-Monitor) aus dem Jahr 2017, an der 6.200 Ärztinnen und Ärzte teilnahmen, betrug die tatsächliche Wochenarbeitszeit von Klinikärzten inklusive aller Dienste und Überstunden im Schnitt 51,4 Stunden. Auch hier kommt mit 20 Prozent eine erkleckliche Anzahl an Kolleginnen und Kollegen auf 60 und mehr Stunden in der Woche. Zum Vergleich: Der Ärztemonitor 2018 von KBV und NAV-Virchowbund ermittelte bei ambulant tätigen Medizinern eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 51,1 Stunden, wobei Selbstständige im Mittel einen Wert von 53,3 und angestellte Ärzte eine Arbeitszeit von 42,8 Stunden angaben.
Im MB-Monitor 2017 gaben 45 Prozent der Befragten an, dass ihr Arbeitgeber die Arbeitszeit elektronisch erfasst, bei weiteren 25 Prozent erfolgt die handschriftliche Erfassung. In drei von zehn Fällen gab es der Umfrage zufolge keine Dokumentation. In der diesjährigen Tarifrunde für die kommunalen Kliniken vereinbarten Arbeitgeber und MB, dass die Arbeitszeiten künftig elektronisch oder auf „andere Art mit gleicher Genauigkeit“ erfasst werden müssen. Dabei gilt die gesamte Anwesenheitszeit als Arbeitszeit. Ein Verstoß gegen die Erfassungs- und Dokumentationspflicht habe damit nicht mehr den Charakter eines Kavaliersdelikts, sondern konkrete Folgen für den Arbeitgeber – es komme nämlich zu einer Beweislastumkehr: „Will der Arbeitgeber bestimmte Zeiten nicht als Arbeitszeit bewertet wissen, muss er künftig beweisen, dass die Ärztin oder der Arzt in der Zeit private Tätigkeiten oder solche Nebentätigkeiten verrichtet hat, die nicht Dienstaufgabe sind“, so der MB. Mehr noch: Da die gesamte Anwesenheitszeit als Arbeitszeit tarifvertraglich vereinbart sei, sei es den Arbeitnehmern nun möglich, persönlich gegen pauschale Kappungen, die unterlassene Erfassung von Zeiten oder nachträgliche Manipulationen vorzugehen. Das gelte auch für den Abzug von Pausenzeiten, „die nach den arbeitszeitrechtlichen Vorgaben zwar hätten gewährt werden müssen, tatsächlich aber nicht gewährt wurden“.
Mit dieser tarifvertraglichen Klarstellung soll den Ärztinnen und Ärzten ein Schwert mit schärferer Klinge in die Hand gegeben werden als dies mit der Überlastungsanzeige bislang der Fall gewesen zu sein scheint. Denn die Erfahrungen, die zum Beispiel die Ärzte gemacht haben, die am MB-Monitor 2017 teilnahmen, sind mehr als durchwachsen: 72 Prozent der Kollegen, die sich zu diesem Fragekomplex äußerten, stellten keine positive Veränderung nach einer solchen Anzeige gegenüber ihrem Vorgesetzten oder der Klinikleitung fest, 13 Prozent berichteten sogar von einer Verschlechterung der Situation. Für 16 Prozent hat sich die Situation gebessert.
Im September hält der MB ein dreitägiges Seminar ab, bei dem interessierte Ärztinnen und Ärzte erfahren können, „mit welchen Strategien, Arbeitstechniken und Kurskorrekturen Sie der tagtäglichen Einladung zum Ausbrennen wirksam und präventiv begegnen können“. Tagungsort für das mit dem Titel „Brennen ohne zu verbrennen – Überlastungsprävention für Ärztinnen und Ärzte“ überschriebene Seminar ist ein Benediktinerkloster, es handelt sich um die inzwischen vierte Veranstaltung dieser Art.
Das internationale medizinische Leitmedium The Lancet (Vol. 394 vom 13. Juli 2019) titelte in einem Editorial kürzlich: „Physician burnout: a global crisis“. Der Artikel macht mit dem Fall eines 32-jährigen Augenarztes in Peking auf, der trotz Fiebers sechs Tage zur Arbeit ging und an plötzlichem Herztod verstarb. Der Mann hinterließ Frau und Kind (ein Jahr alt). China steht laut Lancet mit Problemen wie diesem nicht allein da: 2018 ergab ein Survey, dass 78 Prozent der US-amerikanischen Ärzte schon einmal einen Burnout hatten; 2019 kam die British Medical Association zum Ergebnis, dass vier von fünf Ärzten, insbesondere Ärzte in Weiterbildung („Junior Doctors“) ein hohes oder sehr hohes Risiko für einen Burnout aufweisen.
In der Hartmannbund-Umfrage geben zwei von drei Ärzten an, dass sie ihre Arbeitsbelastung als so hoch empfinden, dass diese sich negativ auf ihr Privat- oder Familienleben auswirkt. 22 Prozent der Teilnehmer befürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen, zehn Prozent geben solche bereits als gegeben an, knapp 15 Prozent leiden unter Schlafstörungen. Hinzu kommt das schlechte Gewissen gegenüber den Patienten: 38 Prozent der Befragten sagen, sie könnten sich nur manchmal „zufriedenstellend viel Zeit“ für ihre Patienten nehmen, weitere 30 Prozent geben an, dass dies gar nur selten der Fall sei. Meist zufrieden mit dem Zeitumfang für den Patienten sind 25 Prozent der jungen Ärztinnen und Ärzte. Drei von zehn Befragten haben bereits überlegt, den Beruf aufzugeben oder die Fachrichtung zu wechseln.
Mit dem Beruf assoziierte Erschöpfungssyndrome, depressive Zustände und Angststörungen sind auch in Deutschland inzwischen ein Thema (siehe auch RÄ 5/2017, Seite 12-14: „Untergrenzen auch für das ärztliche Personal“). Die Suizidrate unter Ärzten liegt doppelt so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Der diesjährige 122. Deutsche Ärztetag in Münster widmete der psychischen wie physischen Gesundheit von Ärzten einen eigenen Schwerpunkt. Dabei verdeutlichten die Delegierten, in welchen Bereichen dringender Handlungsbedarf für den Schutz der Arztgesundheit besteht:
- Konsequente Einhaltung der Arbeitsschutzregelungen einschließlich des Arbeitszeitgesetzes,
- Ausgestaltung der Personalschlüssel auf arbeitswissenschaftlicher Grundlage, sodass eine patienten- und aufgabengerechte Versorgung zu jeder Zeit möglich ist,
- Entlastung von Ärztinnen und Ärzte von Verwaltungstätigkeiten, um ihnen somit mehr Zeit für die Patientenversorgung zu geben,
- Schaffung lebensphasengerechter Präventionsmodelle und Unterstützungsangebote (z. B. flexible Arbeitszeitmodelle) in allen Versorgungsbereichen, damit Beruf, Familie, Freizeit und Pflege von Angehörigen besser miteinander vereinbar werden,
- Einbezug bestehender guter Angebote der gesetzlichen Unfallversicherungsträger und des staatlichen Arbeitsschutzes,
- bessere Organisations- und Personalentwicklung, Abbau starrer Hierarchien, Einführung von Teamarztmodellen,
- ein an der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientierter, wertschätzender und kooperativ ausgerichteter Führungsstil,
- der Aufbau von Fortbildungsangeboten, auch zur Stärkung der Resilienz, sowie Beratungsangebote für belastete Ärztinnen und Ärzte.
Zehn statt 60 Dienste pro Jahr
Irmgard van Bebber-Hansen hat im Jahr 2016 vom Klinikflur in die eigene Praxis gewechselt. Das Besondere: Mit 53 Jahren gehörte sie damals zu den eher spät Berufenen. Viele Jahre habe ihr die Tätigkeit in der Klinik durchaus Möglichkeiten geboten, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, sagt die Mutter von drei Kindern im Gespräch mit dem RÄ. Allerdings war auch für van Bebber-Hansen in jener Zeit nur eine Tätigkeit in Teilzeit drin. „Zudem bot mir die Tätigkeit in der Klinik sehr wenig Gestaltungsspielraum für eigene Ideen, ein persönlicher, selbstbestimmter Arbeitsstil ließ sich kaum verwirklichen“, zieht die Uedemer Hausärztin Bilanz. Heute sehe sie Patienten jeden Alters, die mit vielerlei Anliegen und Erkrankungen zu ihr in die Praxis kämen. „Langweilige Routine kommt da gar nicht erst auf.“ Zudem spüre sie auch die Dankbarkeit ihrer Patienten: „Die Zufriedenheit mit der Tätigkeit ist da natürlich eine andere.“ Ein weiterer Pluspunkt: Statt auf 50 bis 60 Dienste in der Klinik komme sie als ambulant tätige Ärztin heute auf acht bis zehn im Jahr, die man abhängig vom Wohnort auch von Zuhause aus bestreiten könne, berichtet van Bebber-Hansen. „Es mag banal klingen, aber im eigenen Bett liegen zu können statt auf einer Klinikmatratze, das gewinnt mit der Zeit zunehmend an Bedeutung.“ Der Wechsel von der Klinik in die Praxis habe sich zudem auch finanziell positiv ausgewirkt, so van Bebber-Hansen.




