
Das Interesse der Ärztinnen und Ärzte am Thema „Kommunikation im medizinischen Alltag“ ist groß – darauf lässt zumindest der nicht abreißende Strom an Bestellungen des dazu von der Ärztekammer Nordrhein herausgegebenen Leitfadens schließen. Was lag also näher, als sich nach Corona im ersten Kammersymposium, das wieder als Präsenzveranstaltung stattfand, mit diesem Thema zu befassen. Hierbei wurde auch deutlich: Gute Kommunikation ist Ärztinnen und Ärzten nicht in die Wiege gelegt, aber sie ist lernbar.
von Thomas Gerst
Der Aussage, dass eine gute Kommunikation zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin wesentlich zum medizinischen Behandlungserfolg beiträgt, wird wohl niemand mehr widersprechen. Kommunikation gelte deshalb heute als eine zentrale Kompetenz des Arztseins, betonte Dr. André Karger, Oberarzt am Klinischen Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Leiter des Bereichs Psychoonkologie am Universitäts-Tumorzentrum, Universitätsklinikum Düsseldorf, der gemeinsam mit Professorin Dr. Susanne Schwalen, Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer Nordrhein, das Kammersymposium zu der Fragestellung „Wieviel Kommunikation steckt im medizinischen Alltag“ moderierte. Das Erlernen der für eine gute Kommunikation erforderlichen Fertigkeiten sei mittlerweile in der medizinischen Ausbildung bereits curricular gut eingebunden. Die Bewältigung schwieriger Gesprächskonstellationen, wie etwa das Überbringen schlechter Nachrichten, werde mittlerweile in vielen Studiengängen mit Simulationspersonen trainiert, kommunikative Kompetenzen würden im Zuge der Ausbildung überprüft, heißt es dazu in dem von der Ärztekammer Nordrhein herausgegebenen Leitfaden „Kommunikation im medizinischen Alltag“.
Weniger verpflichtend ist laut Karger die Vermittlung kommunikativer Kompetenz in der Weiterbildung geregelt – ein Umstand, der noch von weiteren Referenten im Laufe der Veranstaltung angesprochen wurde, darunter auch vom Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke. „Ich wäre sehr dafür, dass man in den klinischen Fächern die Kommunikation in der Weiterbildung curricular verankert“, merkte er an, wies allerdings gleichzeitig darauf hin, dass hierzu in den zuständigen Gremien noch Diskussionsbedarf bestehe. Es möge Ärztinnen und Ärzte geben, die den Anforderungen von sich aus gerecht werden, so Henke, für die meisten Ärztinnen und Ärzte aber gelte, dass die Regeln der guten Kommunikation schlicht und einfach zu erlernen seien und dass dies systematisch in Aus-, Weiter- und Fortbildung praktiziert werden müsse.
Zuhören und verständlich erklären
Aus Sicht der Ärztekammer Nordrhein zähle eine gute Kommunikationsfähigkeit im Patientenkontakt zu den ärztlichen Kernkompetenzen; Patientinnen und Patienten wünschten sich zugewandte Ärzte, die aufmerksam zuhören und verständlich erklären, betonte Henke. „Diagnose- und Therapiefreiheit bedeutet heute, die Entscheidung während einer Behandlung ganz individuell im Dialog mit dem Patienten in einem ausbalancierten Verhältnis von empathischer Nähe und professioneller Distanz zu treffen.“ Nur wenndiese Kommunikation gelinge, entwickelten Patienten nachhaltig Vertrauen in ihren Arzt, und genau dieses Vertrauensverhältnis sei es, was die Patient-Arzt-Beziehung qualitativ hinaushebe über einen Kunden-Dienstleister-Vertrag, erläuterte Henke.
Für Professor Dr. Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital, Eschweiler, steht außer Frage, dass die Vermittlung bestimmter kommunikativer Kompetenzen, wie etwa Gesprächsführung in schwierigen Situationen oder Besprechungen mit Angehörigen und Zugehörigen, im Rahmen der Weiterbildungsordnung stärker berücksichtigt werden sollte. Gerade auch auf einer Intensivstation seien diese Fähigkeiten enorm wichtig in der Steuerung der Behandlung schwerstkranker Patienten mit einem hohen Sterberisiko. „Die Kommunikation im Behandlungsteam, mit dem Patienten und seinen Zugehörigen beziehungsweise mit seinen juristischen Stellvertretern über die patientenzentrierten Therapieziele ist die Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Indikationsstellung, die nur in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess erfolgen kann“, führte Janssens aus. Nur mithilfe solcher regelmäßigen Gespräche könne im Rahmen der Intensivbehandlung vermieden werden, dass eine nicht angemessene und eventuell sogar sinnlose Behandlung durchgeführt werde.
Intuition allein reicht nicht
Janssens verwies auf Studien, die zeigten, wie wichtig gerade in der Intensivmedizin die Umsetzung kommunikativer Strategien ist. Dort gebe es das Problem des zunehmenden Alters der Patienten und damit einhergehender kommunikativer Defizite, die Zahl der Todesfälle im Krankenhaus mit Inanspruchnahme von Intensivtherapie nehme kontinuierlich zu, Intensivstationen würden zunehmend Orte des Sterbens. Diese Belastung führe auf der Intensivstation im Beziehungsgeflecht von Patient, Behandlungsteam und Angehörigen zu verschiedenen Konfliktkonstellationen. So litten beispielsweise zwei Drittel aller Angehörigen von Intensivpatienten unter Angst oder Depression, was laut Janssens auch auf eine unzureichende Kommunikation mit dem Behandlungsteam zurückzuführen sei. Die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte sollten in der Lage sein, ein Behandlungsteam so zu führen, dass alle Beteiligten zur Sprache kommen, ihre Meinung äußern und diese auch zur Geltung bringen können. Intuition allein reiche hierfür nicht aus, es bedürfe einer kontinuierlichen Schulung in Aus- und Weiterbildung. Für Janssens gehört es zur Kernaufgabe eines Krankenhauses, dass es mit der Kommunikation klappt, was zumeist noch nicht der Fall sei.

Implementierung in die Weiterbildung
Auch Professor Dr. Markus Giessing aus der Klinik für Urologie der Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach bewertet Kommunikationsschulung als essenziell in der Medizin. Deshalb sollte ein solches Training verpflichtend in die Weiterbildungsordnung aufgenommen werden. Für eine erfolgreiche Implementierung bedürfe es aber zugleich der uneingeschränkten Unterstützung durch die Klinikleitung, da die für die Kommunikationsschulung vorzusehenden Unterrichtseinheiten kompensiert werden müssten. Beim Symposium verwies er auf eine Befragung urologischer Weiterbildungsassistenten, nach der gerade bei belastenden Situationen, etwa dem Überbringen schlechter Nachrichten oder dem Ansprechen von Tabuthemen, die eigene kommunikative Kompetenz als unzureichend wahrgenommen worden sei. Mit der kürzlich veröffentlichten KomMent-Studie sei gezeigt worden, dass die Integration eines 80 Unterrichtseinheiten umfassenden Kommunikationstrainings in die Weiterbildung an einer Klinik mit uroonkologischem Schwerpunkt erfolgreich durchführbar sei. Das Kommunikationstraining habe sechs Präsenzworkshops (50 Unterrichtseinheiten) und eine Teamsupervision (10 UE) umfasst. Für das individuelle arbeitsplatzbasierte Training (20 UE) habe es sechs definierte Settings gegeben: Visite, Übergabe, Befundmitteilung, Aufnahme- und Entlassgespräch sowie ein Wunschsetting. Von den teilnehmenden Ärzten sei das sehr positiv bewertet worden; auf die Gespräche mit Patienten und Angehörigen seien sie so besser vorbereitet gewesen.
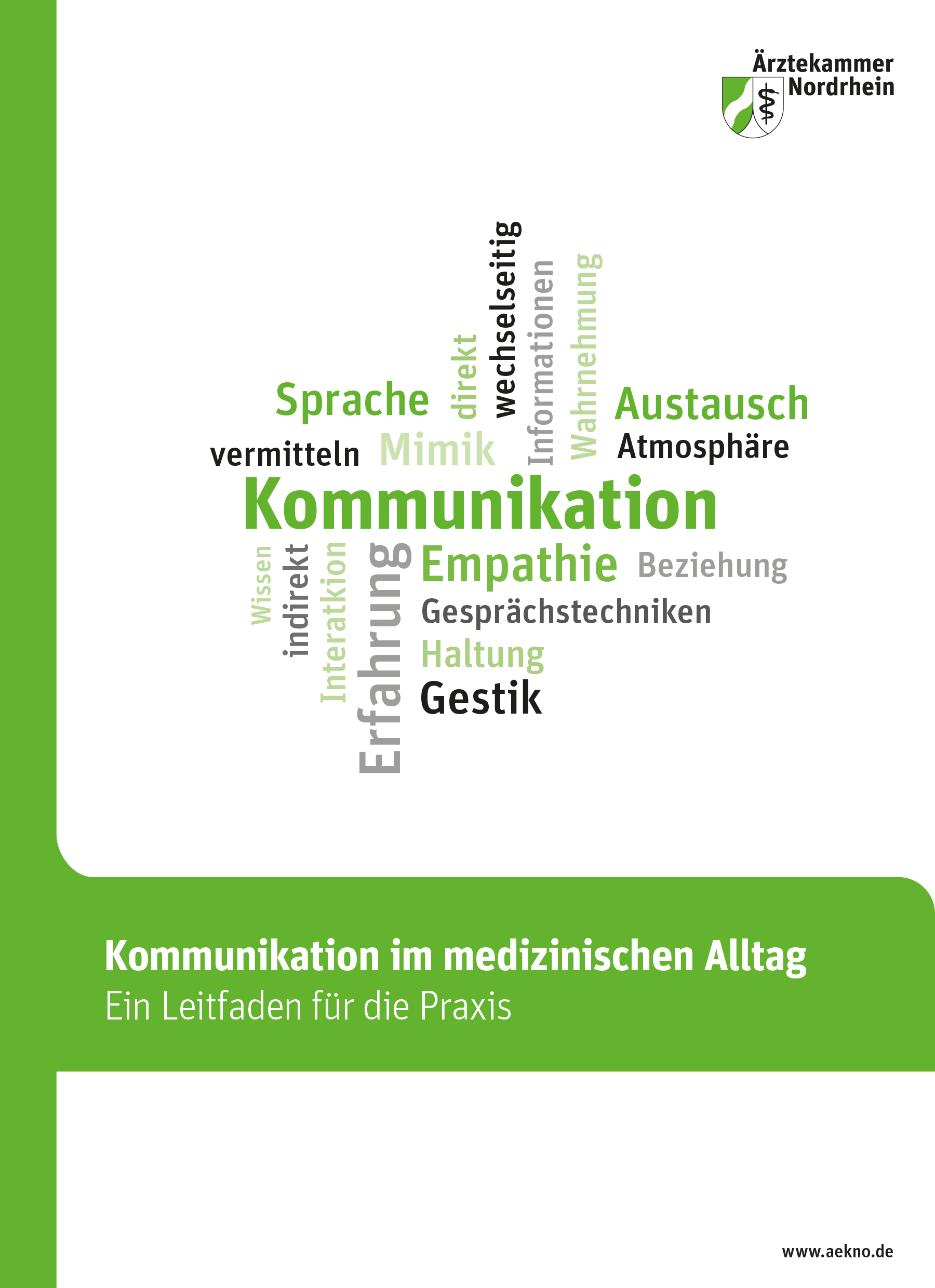
Überarbeitete Auflage erschienen
Der Leitfaden „Kommunikation im medizinischen Alltag“ kann kostenfrei bei der Pressestelle der Ärztekammer Nordrhein, E-Mail: pressestelle(at)aekno.de, Tel.: 0211 4302-2011, Fax: angefordert oder unter www.aekno.de/leitfaden-kommunikation abgerufen werden. Er steht auch als Onlineversion zur Verfügung.



